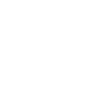Aspects of vine breeding in times of climate change
Planting vines is a far-reaching decision – and not one that winegrowers make overnight. A vineyard must last for the next two generations, and the financial outlay is considerable. It also takes years before the first harvest. In an era of climate change, the choice of grape variety and land becomes an increasingly complex challenge.
April 2025
Source:
Klimawandel & Weinbau. Podcast Wolfgang Staudt with Gast Prof. Hans Schultz, Geisenheim. wolfgangstaudt.com
Wird der Grüne Veltliner auch in Zukunft noch funktionieren? Wird es für den Riesling mit seinem feinen Säuregerüst bald zu heiß? Wie wird der elegante Blaufränkisch mit zunehmendem Trockenstress zurechtkommen und wie werden wir mit dem steigenden Pilzdruck umgehen? Sind pilzwiderstandsfähige Sorten (PiWis) eine Lösung? Dürfen wir über CRISPR/Cas nachdenken? Welche Lagen werden künftig geeignet sein? Und bleibt uns überhaupt genug Zeit, um mit neuen Methoden den Folgen des Klimawandels wirksam entgegenzuhalten?
Es sind Fragen wie diese, die viele Winzerinnen und Winzer derzeit beschäftigen - und ihnen vermutlich auch den Schlaf rauben. Rasche Lösungen gibt es nicht. Aber zukunftsträchtige Überlegungen, Forschungen und Ansätze. Der Präsident der Hochschule Geisenheim Professor Hans Schultz erzählt davon in seinem Gespräch mit Podcast-Gastgeber Dr. Wolfgang Staudt. Der Titel dieser Folge: »Wurzeln schlagen in der Zukunft - Klimawandel, Weinbau und Verantwortung«.
Hans Schultz zählt nicht nur international zu den führenden KlimaexpertInnen im Weinbau, sondern ist auch ein unbeirrbarer Mahner mit Weitblick. In seinem Gespräch mit Wolfgang Staudt benennt er die Herausforderungen des Klimawandels unmissverständlich: steigende Temperaturen, häufigere Wetterextreme, erodierende Böden - und die Illusion, Wasser werde es schon richten.
Während draußen schwerer Hagel niedergeht, fasse ich für Sie den Podcast zusammen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Zeilen ersetzen das Gespräch keineswegs - im Gegenteil: Sie sollen zum Anhören anregen.
Schultz' wichtigste Ausführungen:
-
Klimadynamik und Frostgefahr. Spätestens seit dem Spätfrost 2017, der europaweit Schäden in Milliardenhöhe verursachte, ist klar: Was wir erleben, ist kein Wetterkapriolen-Phänomen, sondern struktureller Klimastress.
- Schultz verweist auf die Dynamik globaler Luftströmungen: Der Jetstream wird durch die arktische Erwärmung instabiler, was zu Kaltluftausbrüchen bis nach Mitteleuropa oder Nordafrika führen kann.
- Um dem zu begegnen, entwickelt die Hochschule Geisenheim seit 2021 eine globale Frostkarte zur Risikoeinschätzung und Standortberatung. Ziel ist es, weltweite Daten zu Spätfrostereignissen und klimatischen Bedingungen zu sammeln und in einer digitalen Karte aufzubereiten. Diese Frost-Risiko-Karte soll Weinbaubetrieben helfen, das Risiko von Spätfrösten an bestehenden und potentiellen Weinbau-Standorten besser abzuschätzen und geeignete Anpassungsstrategien zu entwickeln. -
Boden, Humus und CO2-Speicher
- Böden verlieren durch Erosion, Verdichtung und Übernutzung ihre Wasserspeicherkapazität - und ihre Funktion als lebendiger Speicher.
- Die Rolle des HUMUS wird vielfach unterschätzt. Schultz verweist auf die zentrale Bedeutung von Humusaufbau als langfristige Strategie zur Verbesserung der Bodenstruktur, zur Förderung des Bodenlebens und zur Bindung von Kohlenstoff. Humusreiche Böden können nicht nur deutlich mehr Wasser speichern, sondern sind auch widerstandsfähiger gegenüber Erosion und Extremwetterereignissen. Im Kontext der internationalen Initiative 4 per 1000 betont er, dass der Aufbau von organischem Kohlenstoff im Boden - um 0,4 % jährlich - ein enormes Potenzial zur CO2-Bindung bietet. Gleichzeitig mahnt er, dass dies keine kurzfristige Lösung sei: Der Aufbau funktionierender, stabiler Humusstrukturen erfordere Zeit, geeignete Bewirtschaftungsmethoden und eine systemische Perspektive.
- Die Initiative 4 per 1000 , vorgestellt auf der Weltklimakonferenz 2015 in Paris, verfolgt das Ziel, den organischen Kohlenstoffgehalt in Böden jährlich um 0,4 % zu steigern - eine Maßnahme, die rein rechnerisch den jährlichen globalen CO2-Anstieg deutlich bremsen könnte. Schultz verweist auf dieses Potenzial, macht jedoch deutlich, dass eine solche Steigerung nur durch tiefgreifende agrarische Systemveränderungen erreichbar ist.
- Ein besonders eindrückliches Beispiel für die negativen Auswirkungen fehlgeleiteter Landnutzung sieht Schultz in radikalen Rodungen - etwa in Südfrankreich. Sie führen nicht nur zum Verlust wertvoller Vegetation, sondern auch zu massiven CO2-Emissionen durch die Zerstörung organischer Substanz im Boden. Schultz beziffert die ökologischen und ökonomischen Folgen solcher Eingriffe auf bis zu 100 bis 200 Millionen Euro. Dies verdeutlicht, welches Potenzial verloren geht, wenn Bodengesundheit nicht in langfristigen Strategien mitgedacht wird - und bildet zugleich die Brücke zur globalen Humusinitiative 4 per 1000. -
Begrünung, Biodiversität und Züchtung
- Schultz fordert gezielte Züchtungsprogramme für Begrünungspflanzen, angepasst an Trockenheit, Erosion und Mikroklima.
- Begrünung, Wassermanagement und Bodenintelligenz sind zentrale Zukunftsthemen der Forschung -
Sortenwahl und Resilienz.
- Piwis und Sorten wie Alvarinho zeigen Potenziale für Klimaanpassung. Schultz nennt Alvarinho explizit als Beispiel für eine wärmetolerante Sorte, die unter trockenen und heißen Bedingungen stabile Qualitäten liefern kann. Ursprünglich aus dem Nordwesten der Iberischen Halbinsel stammend, verfügt Alvarinho über eine kompakte Traubenstruktur, dicke Beerenhaut und ein feines Säureprofil.
- Eigenschaften, die sie für den Anbau in wärmeren Lagen interessant machen. Schultz betont jedoch, dass auch solche Sorten nicht überall pauschal eingesetzt werden können. Standortwahl, Bodenverhältnisse und Anbausysteme müssen sorgfältig mitbedacht werden.
- Schultz betont, dass die Wahl der Sorte nicht allein önologisch getroffen werden dürfe, sondern in Bezug auf Standort, Wasserbedarf und Stressresistenz strategisch zu denken sei. -
Bewässerung als Luxus
- Schultz bezeichnet Wasser als Luxusgut, dessen Verfügbarkeit weder selbstverständlich noch unerschöpflich sei.
- Er warnt eindringlich davor, Bewässerung als universale Lösung für Klimawandel-bedingte Stresssituationen zu betrachten.
- Entscheidend sei vielmehr ein präzises, datenbasiertes Wassermanagement: Bewässerung dürfe nur dann erfolgen, wenn sie durch Monitoring-Systeme - etwa Sensorik zur Bodenfeuchte, Transpiration und Blattwasserstatus - konkret begründet werden kann.
- Besonders kritisch sieht er pauschale Bewässerungssysteme in Regionen, in denen bereits heute Grundwasserreserven schwinden.
- Schultz plädiert für angepasste Bewirtschaftungsformen, die auf eine möglichst hohe Wasserspeicherkapazität des Bodens setzen - etwa durch Humusaufbau, geeignete Begrünungen und tiefwurzelnde Rebenunterlagen. -
Langzeitforschung und Bewirtschaftungssysteme.
- Schultz verweist auf Ergebnisse des DOK-Versuchs in der Schweiz und auf Langzeituntersuchungen der Hochschule Geisenheim.
- Biologisch und biodynamisch bewirtschaftete Flächen zeigen in diesen Studien tendenziell eine höhere ökologische Stabilität bei Stresssituationen (z. B. Trockenheit, Schädlingsdruck) als konventionell bewirtschaftete.
- Die Unterschiede betreffen insbesondere Bodenleben, Wasserspeicherung und mikrobielle Vielfalt.
- Schultz betont, dass belastbare Aussagen nur auf Basis von Langzeitforschung möglich seien - oft erst nach 20 Jahren.
- Die Bedeutung des Mikrobioms - insbesondere Mykorrhiza und Bodenorganismen - bezeichnet er als eine wissenschaftliche Blackbox mit großem Zukunftspotenzial. -
Systemische Nachhaltigkeit
- Schultz fordert einenWhole Institution Approach: Nachhaltigkeit müsse sämtliche Bereiche und Prozesse durchdringen - von Bildung über Forschung und Produktion bis zu Verpackung und Logistik. Sehen Sie hierzu auch meinen Zugang als Master of Sustainability in Praxis und Beratung.
- Auch vermeintlich unumstößliche Standards wie die Glasflasche müssten kritisch hinterfragt werden. -
Internationale Perspektive
- Schultz verweist im Gespräch auf mehrere internationale Initiativen, die sich dem Austausch und der aktiven Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Klimawandels im Weinbau widmen - darunter das Porto Protocol, Sustainable Winegrowing Australia und Wine in Moderation. Er betont zugleich, dass es in diesen Netzwerken mehr Engagement wissenschaftlicher Institutionen brauche. Beim Porto Protocol sei derzeit die Hochschule Geisenheim die einzige wissenschaftliche Einrichtung, die sich aktiv einbringe - ein Umstand, den Schultz kritisch anmerkt.
Seit 2019 begleite ich übrigens als Österreich-Repräsentantin das Porto Protocol, eine internationale Initiative für Klimaverantwortung im Weinbau, bei der Wissen, Lösungen und Best Practices vernetzt werden. -
Zukunft denken
- Schultz spricht von Flächenverantwortung: Was passiert mit Rebflächen, wenn der Weinbau nicht mehr tragfähig ist?
- Alternative Produkte aus der Traube - alkoholfrei, kosmetisch, funktional - gewinnen an Bedeutung.
- Schultz sagt: Der Weinbau kann zum Vorreiter im Umgang mit dem Klimawandel werden - wenn wir jetzt handeln.
Es sind durchweg logische Überlegungen - manche neu, manche vertraut. Doch alle verdienen es, in der eigenen Strategie mitgedacht zu werden. Hören Sie sich den Podcast in Ruhe an: Sie werden das eine oder andere Detail neu entdecken.
Gute Reise!
Begrünung, Biodiversität und Züchtung